Prof. Dr. Johannes Goeke
Dr. rer. nat.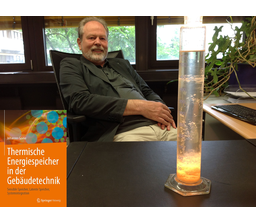
johannes.goeke@th-koeln.de
Sprechstunden
Prof. Dr. Johannes Goeke
Campus Deutz, Betzdorfer Str. 2, Raum ---
Nach Vereinbarung
Beauftragungen
- Haushaltsangelegenheiten
- Studienberatung
Lehrgebiete
- Physik
- Thermische Energiespeicher
- Prozessmesstechnik, Automatisierungstechnik
Forschungsgebiete
-
Thermische Speicher
-
Datenmonitoring
Publikationen
a) Fachbuch - 2021
-
Thermische Speicher in der GebäudetechnikThermische Speicher in der Gebäudetechnik
Goeke, Johannes, November 2021,, Hg.: Springer - Vieweg, ISBN 978-3658345099,
Die Speicherung von thermischer Energie in Form von Wärme und Kälte steht im Mittelpunkt dieses Buches. Inhalt sind die Themenbereiche wassergefüllte Speicher mit sensibler Wärme, latente Wärme-/Kältespeicher mit Phasenwechsel-Materialien sowie das Gebäude als thermischer Speicher. Dazu kommen Anwendungen im Bereich der Gebäude und Quartiere. Dabei liegt der Focus immer wieder auf der Belade- und Entladedynamik der unterschiedlichen Speichertypen.
b) Fachaufsatz - 2025
-
Elektrowärmeversorgung von Gebäuden mit Fotovoltaik - Autarkie?https://elibrary.vdi-verlag.de/zeitschrift/1436-5103
Goeke, Johannes, In Press, Hg.: VDI - HLH
Durch die verbesserte Dämmung von Gebäuden mit immer geringerem Wärmebedarf wird es aus ökologischer und ökonomischer Sicht interessant, den Wärmebedarf des Gebäudes allein auf die Versorgung durch Elektroenergie auszurichten und den größten Teil dieser Wärmeenergie selbst zu erzeugen.
c) Fachaufsatz - 2025
-
Wärmebedarf nach DIN 12831 und der Einfluss der Norm-Außentemperaturhttps://elibrary.vdi-verlag.de/zeitschrift/1436-5103
Johannes Goeke, 2025, Hg.: VDI - HLH
Die Heizlast- bzw. die Wärmebedarfsberechnung gemäß DIN 12831 soll eine ausreichende Genauigkeit für die Ermittlung der Leistung der Wärmeerzeuger in einer Wärmeversorgungsanlage sicherstellen, dazu gehören auch das Rohrnetz und die Raumheizflächen. Es handelt sich hier um ein statisches Berechnungsverfahren, welches die physikalische Realität und die spätere Nutzung nicht vollständig abbildet. Es werden Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) und Wärmedurchlasskoeffizienten (R-Werte) herangezogen, um den Wärmebedarf zu ermitteln. Eine entscheidende Größe bildet dabei die Normaußentemperatur, deren Wirkung in der Planung und Auslegung von Wärmeversorgungsanlagen hier hinterfragt werden soll. Im Focus steht dabei der Temperaturverlauf innerhalb von 24 Stunden, der in Form von Mittelwerten über definierte Zeitintervalle diskutiert wird. Durch neue Annahmen und Voraussetzungen für die Planung von Wärmeversorgungsanlagen wird ein hohes Einsparpotenzial bei den Investitionskosten generiert.
d) Fachaufsatz - 2024
-
Energetische Gewinne von Solarabsorbern im Verbund mit EisspeichernDOI: 10.1002/bapi.202300017
Johannes Goeke, Oktober 2023, Hg.: Bauphysik - Ernst und Sohn
Die Speicherung von Energie ist in der Wärmeversorgung von Gebäuden ein lange be-kanntes Prinzip zur Sicherstellung optimaler Effizienz und im Falle der Einbeziehung erneuerbarer Energie eine Notwendigkeit. Eine neue Form des Eisspeichers als erdvergrabenes Wasserreservoir ist in den letzten Jahren vermehrt zum Einsatz gekommen. Da in vielen Fällen Unklarheit über die solaren Energieflüsse bei der Beladung und bei der Entladung herrschen, werden in dieser Studie die Wärmeübertragungsbedingungen von Solarabsorbern als Wärmequelle sowohl für die Wärmepumpe als auch für den Eispeicher aus Strahlung und Umgebungsluft analysiert. Es werden die thermodynamischen Rand-bedingungen diskutiert, die den Wärmeertrag dominieren und exemplarisch Wärmemengen ermittelt.
e) Fachaufsatz - 2023
-
Messung des Ladezustands von Latentwärmespeicherndoi.org/10.37544/1436-5103
Johannes Goeke, 2923, Hg.: VDI - HLH
Die Kenntnis des Ladezustands eines thermischen Speichers ist für eine Regelung und insbesondere für eine prädikative Regelung einer Wärme- oder Kälteversorgungsanlage unerlässlich. Nur mit einer sinnvollen Regelung lässt sich ein Optimum an Energieeffizienz erreichen. Die Menge der exergetisch verwertbaren Energie in einem thermisch sensiblen Speicher lässt sich mit Hilfe von Temperaturmessungen bestimmen. In einem Latentwärmespeicher dagegen ist eine Bestimmung des Energieinhalts mittels einer Temperaturmessung nur in seltenen Fällen und sehr begrenzt möglich. Diese gelingt nur, wenn es eine temperaturabhängige Schmelzphase des PC-Materials gibt und ein Hystereseverlauf zwischen Schmelzen und Erstarren die temperaturabhängige Auswertung unterstützt. Bei den allermeisten PC-Materialien gelingt dies jedoch nicht. In der Vergangenheit sind immer wieder Verfahren, insbesondere in Form von Patenten entwickelt worden, die eine Bestimmung des Ladezustands ermöglichen sollen. Diese Verfahren werden in diesem Übersichtsartikel vorgestellt und eine neue Methode basierend auf der elektrischen Leitfähigkeit diskutiert.
f) Fachaufsatz - 2022
-
Speichereinsatz - Wärmeerzeugerleistung und Außentemperaturhttps://elibrary.vdi-verlag.de/zeitschrift/1436-5103
Goeke, J., Fonfara, H.,, in Vorbereitung (2022), Hg.: HLH - Springer,
Es wird eine neue Methode vorgestellt, die den thermischen Speicher als zweiten Wärmeversorger im Gebäude betrachtet, der zusammen mit diesem die Versorgung übernimmt. Damit wird die Speicherauslegung mit der Wärmeerzeugerleistung verknüpft. Aus-gleichend über eine bestimmte Zeitperiode (24 h) mit Phasen hohen und niedrigen Bedarfs übernimmt der Wärmeerzeuger und der Speicher gemeinsam die Versorgung. Da die Wärmeversorgung eines Gebäudes in erster Linie von der Außenlufttemperatur abhängt, wird hier Verfahren auf dieser Basis vorgestellt, welches eine einfache Berechnung des Wärmeinhalts eines Speichers ermöglicht.
f) Fachaufsatz - 2021
-
Speichermanagement und Reduzierung der Wärmeerzeugerleistunghttps://elibrary.vdi-verlag.de/zeitschrift/1436-5103
Goeke, J., HLH, BD72, 5 und 7/8, (2021) S. 49-51, Hg.: HLH Springer
Die jahrelang geübte Praxis, die Leistung von Wärmeerzeugern an den größten Bedarf der sogenannten Spitzenlast inklusive diverser Zuschläge anzupassen, führte zu installierten Leis-tungen in stark überhöhter Größenordnung. Dies veranlasste den Wärmeerzeuger im Be-trieb zu starken Taktungen und dabei stellten sich ineffiziente Betriebspunkte ein. Die An-passung von Wärmeerzeugern an die Spitzenlast ist aber beim Einsatz von Wärmespeichern nicht mehr notwendig. Dieses Vorgehen setzt voraus, dass die Größenordnung von Speichern den bisher bekannten Rahmen verlässt und in Größenordnungen vordringt, die dem energetischen Wärmeinhalt eines vier bis achtfachen des Spitzenbedarfs entsprechen. Dann kann in der Regel die installierte Wärmeerzeugerleistung um mehr als die Hälfte reduziert werden. Grund dafür sind die periodischen Wärmebedarfsschwankungen zwischen Tag und Nacht, die häufig bei der Wärmebedarfsdeckung in Gebäuden auftreten. Der Paradigmen-wechsel beinhaltet die Gleichwertigkeit von klassischen Wärmeerzeugern - wie zum Beispiel Gaskessel - und den Wärmespeichern, die dann als gleichwertige Wärmeversorger zu be-handeln sind.
Fachaufsatz
-
Effizienzsteigerung eines Kältenetzes durch Integration eines Speichers (Teil 1)https://www.vde-verlag.de/zeitschriften/euro-heat-and-power.html
Goeke, J., Steffens, F.,, Euroheat & Power, S. 43-48, (2019)
Die Speicherung von Energie ist der zentrale Parameter der Energiewende und bedarf eines verstärkten Ausbaus. Die Erzeugung und Speicherung von thermischer Energie in der Ver-sorgung von Gebäuden oder industriellen Prozessen ist in den meisten Fällen auf die Wärme fokussiert, während in der Speicherung von Kälte viel Effizienzpotential vorhanden ist. Viele Anlagen im Bereich der Kälteversorgung werden heute ohne entsprechend große Speicher betrieben, so dass sich die Kältemaschinen vielfach modulierend im Einsatz befinden. Hier sind deutliche Einsparungen an Primärenergie und Kosten möglich. In dieser Studie wird die Integration eines Speichers in einen Teil des Kältenetzes des For-schungszentrums Jülich simuliert. Die Simulation beruht auf gemessenen Verbrauchsdaten eines Monitorings im Jahre 2015. Es wird deutlich, dass durch die Steigerung des Efficiency-Energy-Ratio (EER) und die Verwendung von Nachstromtarifen eine verbesserte ökonomi-sche Bilanz erreicht werden kann. -
Seasonal thermal storage in buildingshttps://www.vde-verlag.de/zeitschriften/euro-heat-and-power.html
Johannes Goeke, Albert Popp, Euroheat & Power III, (2016), S. 20-27
This study is based on draft planning for a high-rise building from the VDI competition "Integral Planning" from the years 2014/15 entitled "Energy-Efficient High-Rise". The Technical University of Cologne submitted a draft plan for this building, which, as a particular feature, includes an integrated hot water storage facility located near the central height axis of the high-rise. It is continuously charged with solar energy via flat-panel collectors. The heat-supply systems include not only the flat-panel collectors, but also a conventional gas boiler or, alternatively, a CHP (combined heat and power) system fueled by biogas, operated in combination. -
Hybrid-Wärmespeicher mit Wasser und PCM-Granulathttps://elibrary.vdi-verlag.de/zeitschrift/1436-5103
Johannes Goeke, Andreas Henne, Pascal Büttgen, HLH 67, (2016) Nr.5, S. 18- 22, Nr.6, S. 23-27, Hg.: Springer,
In der vorliegenden Arbeit wird ein thermischer Energiespeicher (TES) auf Basis eines Phasenwech-selmaterials (PCM) und Wasser mit einem Energieinhalt von 22 bis 27 kWh abhängig von der maxi-malen Speichertemperatur von 60°C vorgestellt. Die Phasenwechselgrenze des PCM liegt bei einer Temperatur von 43°C. Der Speicherinhalt besteht aus zwei Teilen: einem hochdynamischen Spei-cher von 400 l Wasser mit sensibler Wärme und einem eingeschränkt dynamischen Speicher von 300 kg PCM-Granulat mit sensibler und latenter Wärme. Durch den Wasseranteil kann der Speicher sehr schnell be- und entladen werden. Durch den Pha-senwechsel wird zusätzlich Wärmeenergie zeitlich verzögert aufgenommen. Neben der allgemei-nen Funktionsweise des Speichers und der Vorgänge bei der latenten Wärmespeicherung interes-siert besonders die Leistung des Speichers. Diese wird durch die Zeit-Ladefunktion Q(T,t), also die Abhängigkeit der Ladezeit von der wirksamen Temperaturdifferenz, repräsentiert. Darüber hinaus gibt die Austauschkapazität CA(T,t) Auskunft über die Leistungsfähigkeit und die Dynamik des Spei-chers. Die genannten Funktionen erlauben es, die Reaktion des Speichers auf schwankende Wär-meangebote zu beurteilen. -
Vergleich der konstruktiven Speichertechnik von PCM Wärmespeichernhttps://elibrary.vdi-verlag.de/zeitschrift/1436-5103
J. Goeke, B. Otten, HLH - Springer, Bd.3, 2015, Hg.: VDI
Es werden zwei thermische Wärmespeicher auf Basis eines Phasenwechselmaterials (PCM – NA58) mit einem Energieinhalt von 40 kWh und einem latenten Temperaturniveau von 58°C vorgestellt. Ein Speicher ist mit einem Plattenwärmetauscher ausgestattet und gefüllt mit reinem Natriumacetat-Trihydrat (NA58). Der andere Speicher besteht aus einem Rohrwärmetauscher gefüllt mit einer Mischung aus Natriumacetat-Trihydrat und Graphit. Die beiden unterschiedlichen Konzepte der Wärmeübertragung werden miteinander verglichen und die Ladedynamik der Speicher wird vorgestellt. Insbesondere die Ladefunktion Q(t,T), also die Abhängigkeit der Ladezeit von der wirksamen Temperaturdifferenz wird diskutiert. -
Forschungsklimaanlage am TGA-Institut der Fachhochschule KölnA. Henne, J., Goeke, H., Bley (2011)
A. Henne, J., Goeke, H., Bley, HLH 2, 22-28, 2011, Hg.: Springer
h) Fachaufsatz 2020
-
Jahresdauerlinien und Beladungssystematik von thermischen Speichernhttps://elibrary.vdi-verlag.de/zeitschrift/1436-5103
Goeke, J., HLH 71/9 Teil 1 (2020), S.18-21, Hg.: Springer,
Die Nutzung der Speicher insbesondere das Speichermanagement bei größeren Gebäuden erscheint aber in vielen Betriebsprozessen verbesserungswürdig. Dabei hilft die Analyse der periodischen Schwankungen und die Jahresdauerlinie des Wärme- und Kältebedarfs. Das Verhalten der Jahresdauerlinie gibt Aufschluss über die Größenordnung von maschinellen Wärmeerzeugern und dem daraus resultierenden Einsatz von thermischen Speichern. Betrachtet man dazu den Verlauf von Jahresdauerlinien z.B. beim größten Wärmebedarf, so kann in vielen Fällen die installierte Spitzenlast der Wärmeerzeugung durch einen thermischen Speicher und ein angepasstes Speichermanagement ersetzt werden.
i) Fachaufsatz 2020
-
Phasenwechselmaterial in Kugelkapseln für thermische HybridspeicherGoeke, J., Schwamborn E., (2011)
Goeke, J., Schwamborn E.,, Chemie Ingenieurtechnik, 92/8 (2020), S. 1098-1108
Die experimentellen Untersuchungen widmen sich den Belade- und Entladeeigenschaften des in Kugeln makroverkapselten PCM. Die Abhängigkeit der spezifischen Wärmeübertragungsleistung eines Hybridspeichers hängt unmittelbar von der Größe der Kugeln als auch von der spezifischen Wärmeleitfähigkeit des PC-Materials ab. Sie definiert das thermische Einsatzgebiet. Die Darstellung dieses Zusammenhangs in Kombination mit der nichtlinearen Abhängigkeit der spezifischen Wärmeübertragungsleistung von der Temperaturdifferenz zwischen PCM-O und WTF ist Inhalt dieser Studie.
j) Fachaufsatz 2019
-
Wärmedurchgangskoeffizient von begrünten DächernPort, L., Goeke, J.
Port, L., Goeke, J., Bauphysik, Bd. 41, S. 233- 242, (2019),, Hg.: Wiley&Sons,
In der hier vorliegenden Studie werden Moosmatten auf ihre Wärmeleitfähigkeit (λ) und den thermischen Widerstandswert (R-Wert) untersucht. Im Fokus stehen dabei sowohl der strukturelle R-Wert ohne Änderung des Wassergehalts als auch der effektive R-Wert, der insbe-sondere durch die Änderung der latenten Energie gekennzeichnet ist. Die Ergebnisse werden mit den Resultaten ähnlicher Dachbegrünungen von Studien anderer Autoren der letzten Jahre verglichen und in Beziehung gesetzt. Damit soll die Berechnung der thermisch, energetischen Aktivität der Gebäudehülle unterstützt und die Transmissionwärmeverluste quantifizierbar werden.
k) Fachaufsatz 2019
-
Wärmeübertagung in Eisspeichern und Energiegewinne aus dem ErdreichBauphysik - DOI: 10.1002/bapi.201900001
Goeke, J.,, Bauphysik, Vol. 41 Bd. 2 (2019), S. 96-103, Hg.: Wiley&Sons
Die Speicherung von Energie ist in der Wärmeversorgung von Gebäuden ein lange bekanntes Prinzip zur Sicherstellung optimaler Effizienz und bei der Einbeziehung erneuerbarer Energie eine Notwendigkeit. Eine neue Form des Eisspeichers als erdvergrabenes Wasserreservoir ist in den letzten Jahren vermehrt zum Einsatz gekommen. Da in vielen Fällen Unklarheit über die möglichen Energieflüsse bei der Beladung und bei der Entladung herrschen, werden hier die Wärmeübertragungsbedingungen des Entzugswärmeübertragers im Eispeicher und die Wärmegewinne aus dem Erdreich diskutiert werden.
l) Fachaufsatz 2019
-
Energiebilanzen des VDI-Musterhauses (Solare Gewinne und Elektrowärmegewinne)
Goeke, J., Henne, A., Lambertz, M.,, GI, Vol. 140, Bd.2, (2019), S. 150-159, Hg.: Recknagel,
In der vorliegenden Studie wird die Nutzung solarer Energie in Form von solaren Energiege-winnen durch Fensterflächen und die Nutzung der Wärme elektrischer Verbraucher im Focus stehen. Dabei wird ein Optimum zwischen der Größe der Fensterflächen, den solaren Ener-giegewinnen und der dazu in Konkurrenz stehenden Elektrowärme gesucht. Grundlage der Simulation bildet ein Musterhaus wie es in der VDI 6009 definiert ist und wel-ches auf den heutigen EnEV-Standard 2016/18 angepasst wurde.
m) Fachaufsatz 2017
-
Energieeffizienz eines Schichtenspeichershttps://www.vde-verlag.de/zeitschriften/euro-heat-and-power.html
Goeke, J., Billstein, P.,, Euroheat&Power (2017)
-
Autarkie - Tendenzen der solarthermischen SelbstversorgungBauphysik - DO1: 10.1002/bapi.201900021
Goeke, J., Krükel, F.,, Bauphysik 39, 2, 2017, S,114-120, Hg.: Ernst & Sohn (Wiley),
- Unter Autarkie in Gebäuden versteht man im Allgemeinen die Selbstversorgung mit elektri-scher Energie und Wärme. Wir haben uns hier allein auf die Wärmeversorgung konzentriert und stellen eine Untersuchung vor, der frei verfügbare Daten über teilweise selbstversorgende Gebäude zugrunde liegen. Im Wesentlichen wird hier die Teilautarkie bzw. der Autarkiegrad der Selbstversorgung von Gebäuden mit Wärme betrachtet, da komplett selbstversorgende Gebäude bisher kaum realisiert wurden. Der Autarkiegrad bezieht sich dabei sowohl auf die Erzeugung von Wärmeenergie als auch auf deren Verbrauch in den Bilanzgrenzen des Gebäudes. Die Auswertung betrachtet die entscheidenden Größen wie den Wärmebedarf, die solare Wärmeproduktion in Form der Kollektorfläche der Solarpanels und den maximalen Energieinhalt von Warmwasserspeichern. Damit ein Vergleich unabhängig von der Gebäudegröße gemacht werden kann, werden aus diesen Daten Relationen (Autarky Performance Indicators) gebildet und zum Autarkiegrad in Beziehung gesetzt. Dabei werden Tendenzen bezüglich der Kollektorflächen und den Speicherinhalten im Verlauf der Trendlinien des Autarkiegrades sichtbar.
n) Fachaufsatz 2011
-
Energierückgewinnung und Data-Mappinghttps://elibrary.vdi-verlag.de/zeitschrift/1436-5103
J., Goeke, M., Tiedemann, B., Ufermann,, HLH 7, 22-26, 2011, Hg.: Springer
n) Fachaufsatz 2013
-
Speicherdynamik von Kältespeichern mit PCM-Compound Materialfüllunghttps://www.researchgate.net/profile/Johannes_Goeke/contributions?ev=prf_act
J., Goeke, A., Henne, HLH 2, 21-27, 2013, Hg.: Springer
Das Verhalten von Speichern zur Kühlung von Gebäuden, deren Speicherfähigkeit auf der Phasenumwandlung von PCM-Materialien von flüssig nach fest beruht, ist noch ungenügend untersucht. Insbesondere die Schnelligkeit des Wärmetransports aus dem Volumen hin zu den Tauscherrohren mit einer kalten Flüssigkeit entscheidet über den Einsatz als Speicher. Der Fokus liegt hierbei auf einer Speicherkapazität von mehr als 50kWh, welche durch die Außenluftkälte und die Wärmeaustauscher eines Freiluftkühlers in der Nacht gekühlt werden sollen. Die Zeit für die Kühlung der Speicher und der angestrebten Phasenumwandlung liegt unter 6 Stunden.
n) Fachaufsatz 2015
-
Time - Temperature charge function of a high dynamic thermal heat storage with phase change materialEnergy and Power Engineering
J. Goeke, A. Henne, Energy and Power Engineering, 2015, Hg.: Scientific Research
A thermal heat storage system with an energy content of 40 kWh and a temperature of 58°C will be presented. This storage system is suitable for supporting the use of renewable energies in buildings and for absorbing solar heat, heat from co-generation and heat pumps or electric heat from excess wind and solar power. The storage system is equipped with a plate heat exchanger that is so powerful that even with small temperature differences between the flow temperature and the storage temperature a high load dynamic is achieved. The storage system has a performance of 2.8 kW at 4 K and 10.6 kW at a temperature difference of 10 K. Thus, large performance variations in solar thermal systems or CHP plants can be buffered very well. Further a storage charge function Q(T,t) will be presented to characterize the performance of the storage.
o) Fachaufsatz 2010
-
Wärmerückgewinnungssysteme in der Praxishttps://elibrary.vdi-verlag.de/zeitschrift/1436-5103
J., Goeke, L., Roth, HLH 8, 33-38, 2010, Hg.: Springer
-
Messung der Phasenfrontgeschwindigkeit und der Energiespeicherung von PCM-Compoundmaterialienhttps://elibrary.vdi-verlag.de/zeitschrift/1436-5103
J., Goeke, K., Ruhbach, A., Henne, HLH 1, 49-53, 2010, Hg.: Springer
t) Fachaufsatz 2005
-
Effects of Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Electromagnetic Fields on the Blood-Brain Barrier in Vitrohttps://www.researchgate.net/profile/Johannes_Goeke/contributions?ev=prf_act
Franke, H.; Streckert, J.; Bitz A.; Goeke, J.; Hansen V.; Ringelstein E.B. and Stögbauer F.,, Radiation Research, Vol. 164, 2005, 258-269
u) Fachaufsatz 2002
-
Raumcomputer oder Facility-System-Serverhttps://www.tab.de
J. Goeke, K. Jäkel, 2002, Hg.: TAB
Moderne Bürogebäude müssen sich in sehr kurzer Zeit und oh ne großen Aufwand räumlich, technisch und organisatorisch an wechselnde Nutzer und sich häufig ändernde Nutzungsfor men anpassen können. Dies erfordert, dass Gebäude Dienste übernehmen und in integrierter und intuitiv erlernbarer Wei se ihren Nutzern anbieten, die gegenwärtig noch von verschie denen Systemen der klassischen Gebäudetechnik und von ver schiedenen Informationssystemen erbracht werden.
v) Fachaufsatz 2000
-
Electromagnetic Fields (1.8GHz) increase the permeability to sucrose of the of Blood-Brain-Barrier in vitrohttps://www.researchgate.net/profile/Johannes_Goeke/contributions?ev=prf_act
A. Schirrmacher, S. Winters, St. Fischer, J. Goeke, H-J, Galla, U. Kullnick, E.B. Ringelstein, F. Stögbauer, Bioelectromagnetics, Vol. 21(5):338-345, 2000
Vorträge
-
Thermische Speicher
Neue Entwicklungen im Bereich der thermischen Speichern, neue Speicherkonstruktionen
21.02.2017, TH-Karlsruhe / VDI-DKV -
Thermische Speicher
Einsatz von thermischen Speichern im Bereich der Quartiere (Smart heating district) und Gebäude zu Wärme-als Kälteversorgung.
Hermann Rietschel Institut, TU-Berlin, 17.03.2015 -
Wärmespeicher in Plattenwärmeübertrager
Ein Wärmespeicher in Plattenwärmeübertragetechnik mit einer Füllung aus Natriumacetat - Trihydrat wird vorgestellt. Dazu wird die Lade- und Entladynamik diskutiert.
Energiespeichertagung OTTI, 1.07.2015 -
Thermische Speicher mit Phasenwechselmaterial
VDI-Vortrag
23.03.2014
Mitgliedschaften
-
Deutsche Physikalische Gesellschaft
-
VDE Verein Deutscher Elektrotechniker
Auszeichnungen
-
Einfluss von Feststoffen in einer Flüssigkeitsströmung auf die Coriolis-Massemessung
atp-award 2004 - Beste Publikation atp Vol. 48/11,S. 71-76
