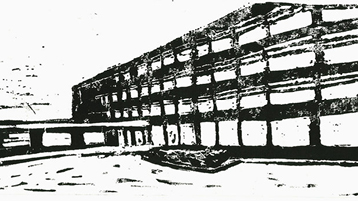Laufen, um zu kaufen

Innenstädte sind geprägt durch Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen. Dabei bereitet der Onlinehandel dem Einzelhandel wie auch großen Ketten zunehmend Probleme, die teuren Retail-Flächen der Innenstädte zu halten. Corona hat diesen Trend beschleunigt. Ein guter Zeitpunkt, nachhaltiger den Wandel der Innenstädte anzugehen, findet Architektin Prof. Yasemin Utku.
Unabhängig von Corona: Sind unsere Innenstädte noch zeitgemäß?
Das ist relativ. So wie es ganz unterschiedliche Stadttypen und regionale Unterschiede gibt, so gibt es auch unterschiedliche Typen oder „Charaktere“ von Innenstädten. Aber es gibt natürlich ein Thema, das für alle gilt: die Transformation im Einzelhandel trifft alle Innenstädte, da wir unsere Zentren im Wesentlichen zum Einkaufen nutzen. Zumindest bisher. Durch die Digitalisierung und den Online-Handel verlieren Innenstädte als Einkaufsorte mit ihren Fußgängerzonen und großen Verkaufsflächen zunehmend an Bedeutung. Auch im Büro- und Dienstleistungsbereich wird sich einiges verändern. Das stand bereits vor Corona fest, die Pandemie ist da lediglich ein Beschleuniger.
Bisher sind Innenstädte wie Köln stark geprägt von Einkaufsmeilen und Retail-Flächen. Wie wirkt sich diese Monokultur auf die Bewohnerinnen und Bewohner aus?
Die starke Fokussierung der Innenstädte auf Einkaufen und Konsum ist ein Kernproblem. Gerade in den Innenstädten befinden sich vielfach kleine Wohnungen und der Wohnraum ist häufig recht beengt, da möchten die Menschen verständlicherweise den öffentlichen Raum nutzen, und das in vielfältiger Weise – nicht nur in der derzeitigen Situation. Es braucht Räume, in denen man einfach so Zeit verbringen kann, konsumfrei. Räume, die Lust darauf machen, spazieren zu gehen, die aber vielleicht auch irgendeine Form von Erlebnischarakter haben und die für individuelle Aktivitäten angeeignet werden können. Wir können ja bereits seit Jahren beobachten, dass vor allem jüngere Menschen den öffentlichen Raum nutzen, um alternative Aufenthaltsorte zu schaffen, die selbst Sitzgelegenheiten bauen und aufstellen oder Beete anlegen. Diese Initiativen zeigen, dass es da einen Bedarf gibt, und es wäre wünschenswert, wenn die Stadtplanung solche Aktivitäten offensiv unterstützt.
Stadtplanung heißt an der Stelle also auch, den Menschen Freiräume zu schaffen statt Verbote auszusprechen?
Genau das sollte ein wichtiger Punkt zukünftiger Stadtentwicklung sein: Mehr Offenheit, Experimente zulassen und dafür Freiräume ermöglichen. Es gibt zahlreiche bürgerschaftliche Initiativen, die sich Gedanken machen, wie man den öffentlichen Raum als Wohnumfeld attraktiver machen kann, damit Innenstädte nicht nur der Raum sind, in dem man arbeitet und einkauft. Diese Ideen und Konzepte der Raumaneignung können nicht aus der Stadtverwaltung kommen, denn dafür gibt es dort einfach zu viele Rahmensetzungen. Durch mehr Räume für Begegnung, vielfältig und in kleineren Einheiten, entwickelt sich auch wieder eine aktive und vitale Nachbarschaft, die man sonst vielleicht eher mit dem Leben im Quartier oder im Vorort verbinden würde.
Gerade in den Innenstädten sind Miet- und Immobilienpreise sehr hoch und im Visier von Immobilienkonzernen. Kann eine Stadt solche Umwandlungsprozesse alleine umsetzen, oder braucht es dazu staatliche Regulierung?
Programme für die Förderung der Stadterneuerung wie beispielsweise die „Soziale Stadt“ und den „Stadtumbau“ gibt es seit vielen Jahren, auch Programme speziell für Stadt- und Stadtteilzentren. Es ist gut, dass der Bund und die Länder zunehmend Förderprogramme für die Entwicklung der Innenstädte auflegen und damit auch auf die Effekte durch die Pandemie reagieren, aber es dürfen jetzt auch keine Schnellschüsse in nur eine Richtung erfolgen. Die Kommunen können steuernd in die Stadtentwicklung eingreifen, aber in der Regel sind sie auch nur ein Player unter vielen, denn der Druck von möglichen Investoren auf die Flächen ist häufig groß. Eine wichtige Stellschraube für die kommunale Steuerung ist daher der städtische Grund und Boden: Die Städte müssen umdenken und ihre Flächen, oder Flächen, die sich gerade in einem Transformationsprozess befinden, nicht mehr nur zum Höchstpreis vermarkten. Vorrang müssen gute Konzepte bekommen, die alle Bevölkerungsgruppen berücksichtigen und Beiträge für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung leisten. Einzelne Projekte sind dabei genauso bedeutsam wie größere Standortentwicklungen. In Köln gibt es Ansätze, die in diese Richtung weisen, beispielsweise das Modell der Konzeptvergabe oder das Kooperative Baulandmodell. Auch bei einzelnen Projekten werden neue Wege gegangen, ob es der Umbau der Stadtbibliothek in Köln-Kalk zu einem so genannten „Dritten Ort“ ist, die Bildungslandschaft Altstadt-Nord oder die Entwicklung des Heliosgeländes in Ehrenfeld – um nur mal drei Beispiele in zentralen städtischen Lagen zu nennen. Es sind häufig private Initiativen, außerdem Genossenschaften, die neue Projekte anstoßen. Ich bin selber im Vorstand einer Dachgenossenschaft für Quartiers- und Wohnprojekte. Ein Ansatz dahinter ist natürlich auch, den Boden der Grundstücksspekulation zu entziehen.
Die Städte müssen umdenken und ihre Flächen nicht mehr nur zum Höchstpreis vermarkten.
Und der Leerstand von gewerblichen Flächen wird durch Corona zunehmen.
Gerade bei Immobilien in bester Innenstadtlage, die jetzt leer stehen oder absehbar leer stehen werden, haben Kommunen Chancen einzugreifen und bei der Nach- oder Umnutzung der Objekte mitzugestalten. Es muss nicht direkt das scharfe Schwert der Enteignung im Rahmen einer Sanierungssatzung sein, man kann auch auf die Eigentümer zugehen und gemeinsam überlegen, wie man die Immobilie aktivieren kann. Gute Beispiele der Umnutzung sammelt zum Beispiel die Landesinitiative Baukultur NRW und publiziert sie. Da finden sich zum Beispiel ehemalige Kaufhäuser, die zu Wohnungen oder für Start-ups bzw. Coworking-Spaces umgebaut wurden, aber auch Ideen und Konzepte für einzelne Ladenlokale oder ganze Geschäftsstraßen. Es gibt erst einige wenige Städte, wie die Stadt Offenbach, die aus meiner Sicht schon einen Schritt weiter sind und ihre Innenstadt „neu erzählen“ wollen: Einkaufen steht dort nicht mehr im Mittelpunkt, sondern das Stadtzentrum als Ort, um sich zu treffen, um etwas zu erleben, Kultur und Bildung wahrzunehmen und um sich Räume anzueignen. Die Stärkung und Qualifizierung dieser Nutzungen braucht Raum und die „Dritten Orte“ könnten solche Angebote bündeln und Ankerpunkte in der Innenstadtentwicklung sein – im günstigsten Fall mit der Nachnutzung von leerstehenden Gebäuden. Das kann einen neuen, einen gemeinwohlorientierten Stadtcharakter befördern und hier sind den Ideen keine Grenzen gesetzt.
Also hätte es für die Gestaltung der Innenstädte eigentlich etwas Gutes, wenn sich Konsum und Handel immer mehr ins Digitale verlagern?
Es bietet sich jetzt eine große Chance, die Innenstädte in aller Konsequenz wieder zu Zentren für die Stadtgesellschaft in ihrer Diversität und Vielfalt zu machen. Allerdings muss jede Stadt ausgehend von ihrer Stadtstruktur für sich ableiten, welche Themen für ihr Zentrum sinnvoll und wichtig sind und welches Bild und welchen Nutzungsmix sie dafür entwickeln möchte. Einzelhandel kann dabei auch ein Nutzungsbaustein sein. Städte wie z.B. Münster oder Bonn, in denen Hochschulstandorte in der Stadt verteilt sind, bringen durch das studentische Leben eine Vitalität mit, die auch den Charakter der Innenstadt prägt. Da stellt sich meines Erachtens schon die Frage, warum Bildung oder Kultur nicht überall eine größere Präsenz in den Zentren haben und unsere Innenstädte vor allem für das Einkaufen über die Jahre quasi „ausverkauft“ wurden.
Können Städte durch einen multi-funktionalen Mix flexibler und resilienter werden für kommende Entwicklungen?
Unbedingt! Wenn kleine Flächen leer stehen, fällt das weniger ins Gewicht als bei großen Komplexen. Die Körnigkeit bzw. Maßstäblichkeit der baulichen Anlagen und Stadtstrukturen ist für die Nachnutzung ein ebenso wichtiger Faktor wie der Nutzungsmix. Die Anpassung, Erneuerung und Entwicklung von Stadtbausteinen, Objekten und Räumen für sich verändernde Nutzungsanforderungen sind Daueraufgaben in der Stadtentwicklung. Und dabei sollte es auch darum gehen, mal etwas Neues zu versuchen, statt immer nur das zu wiederholen, was schon da ist. Dafür wünsche ich mir mehr Offenheit und Experiment in unseren Innenstädten.
September 2021